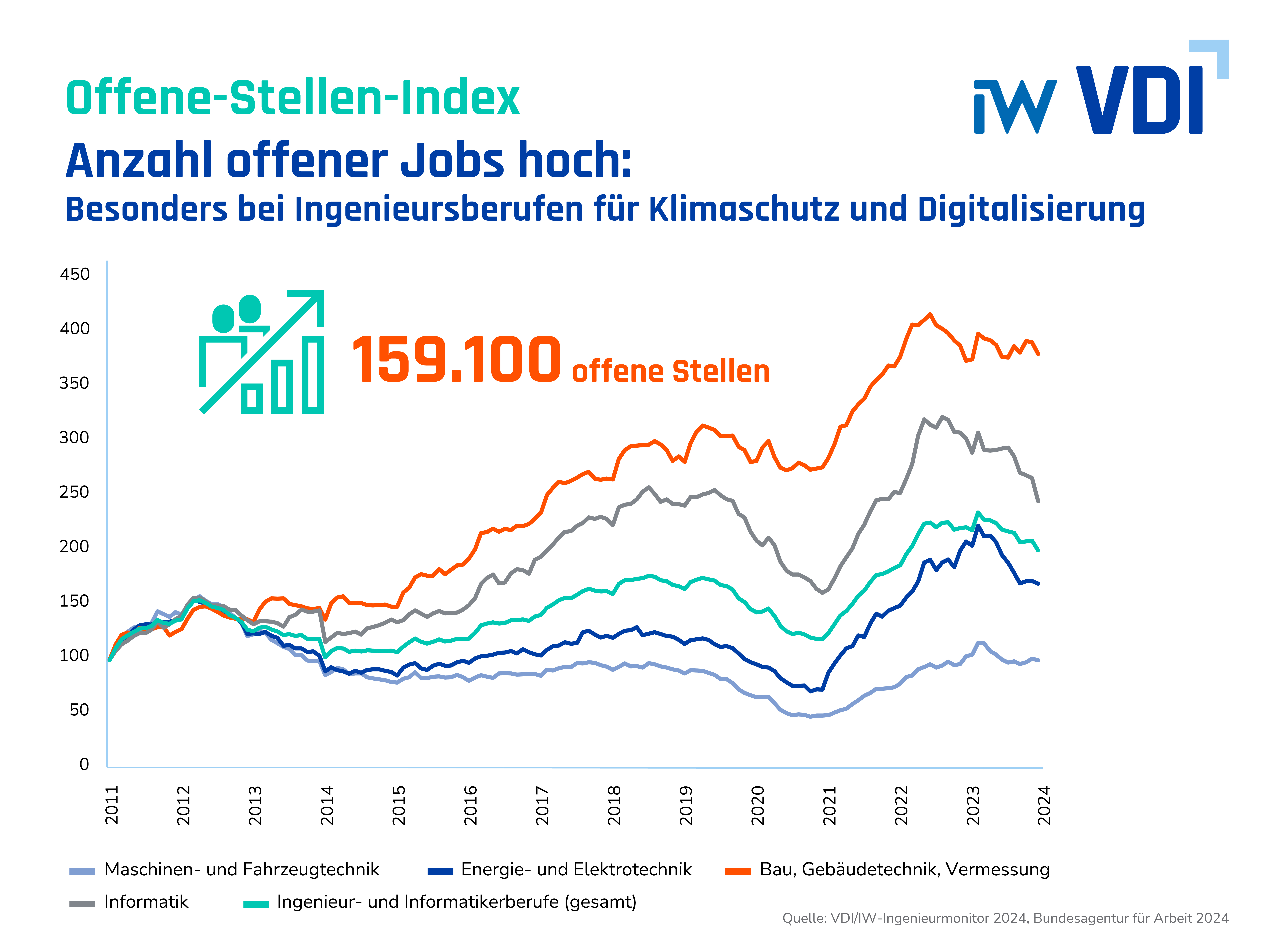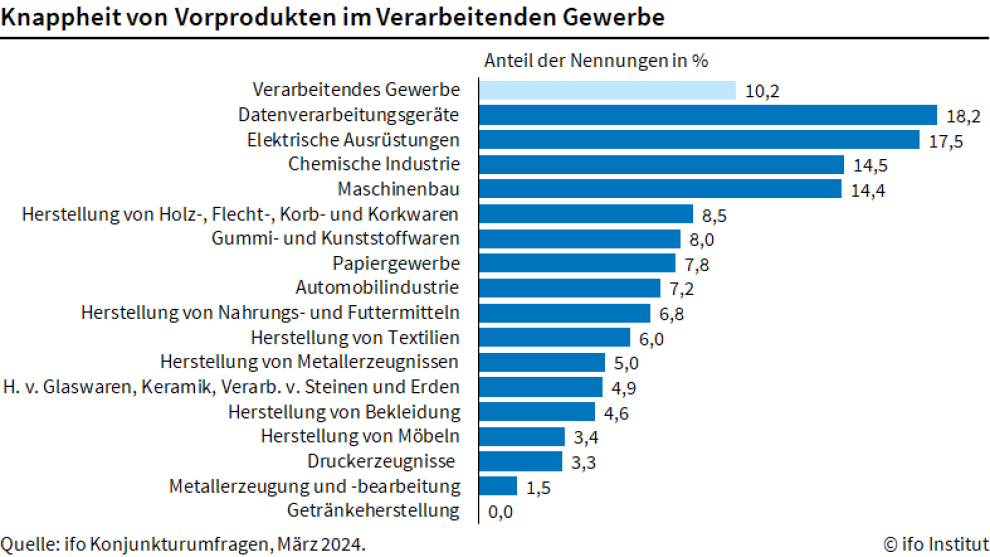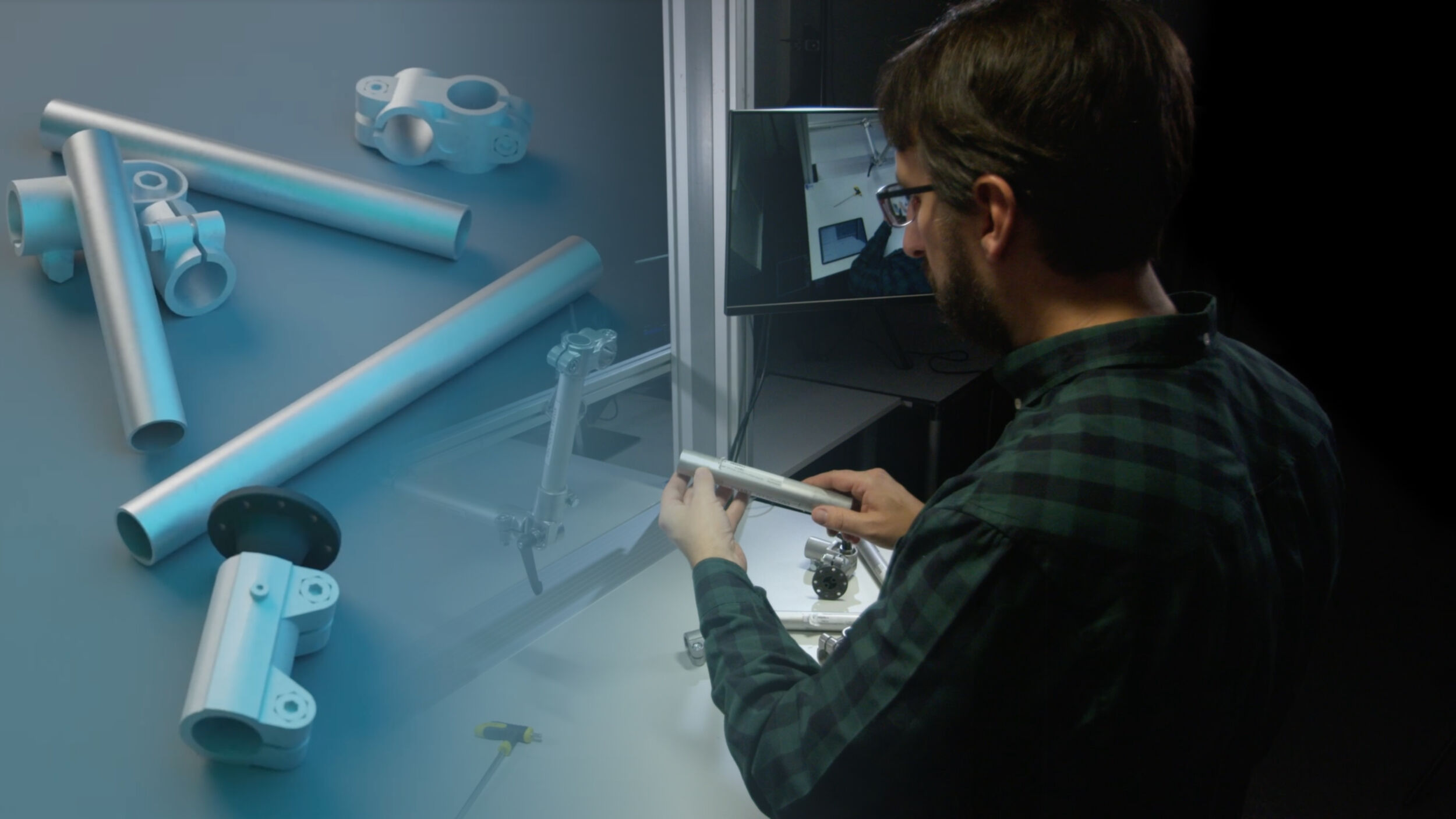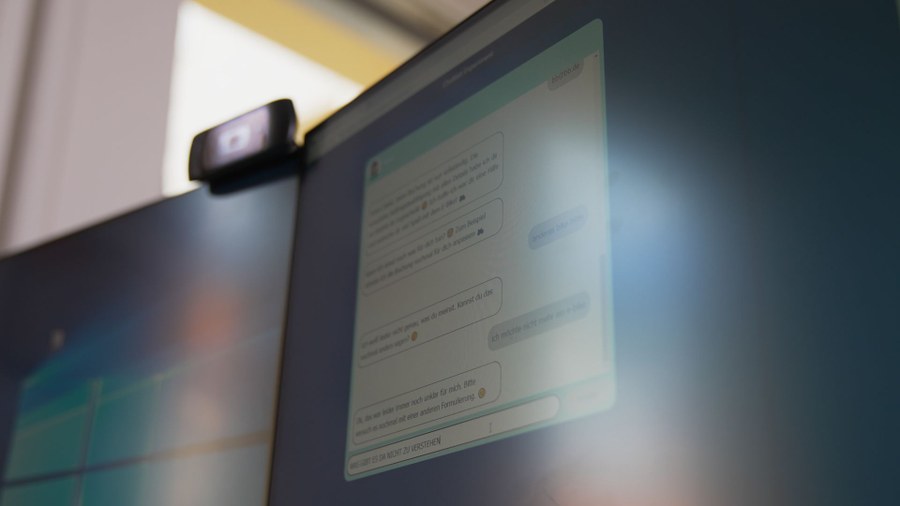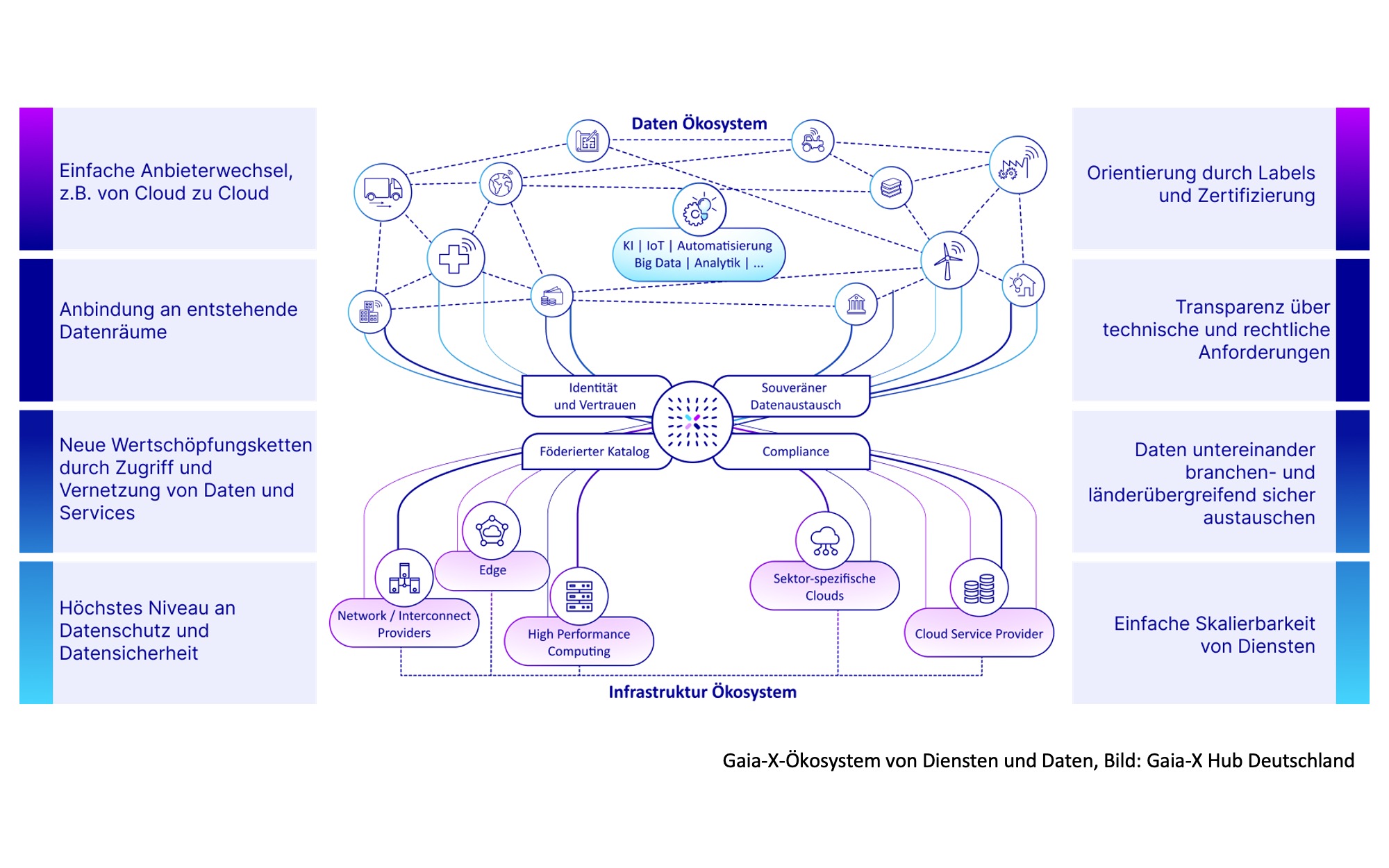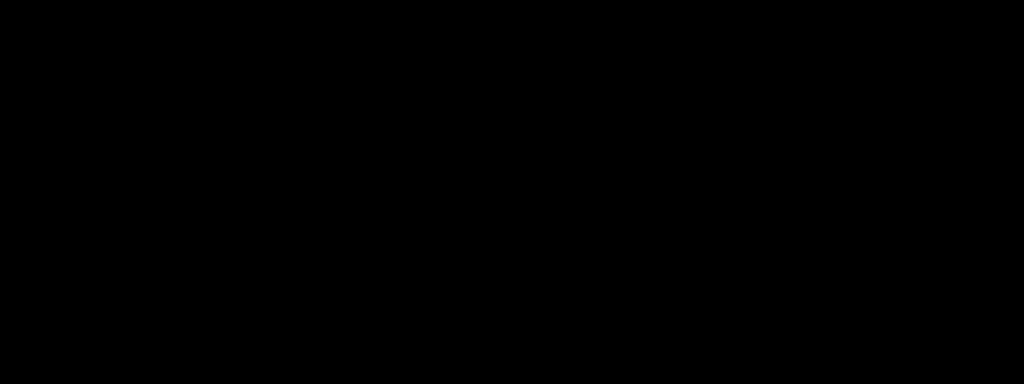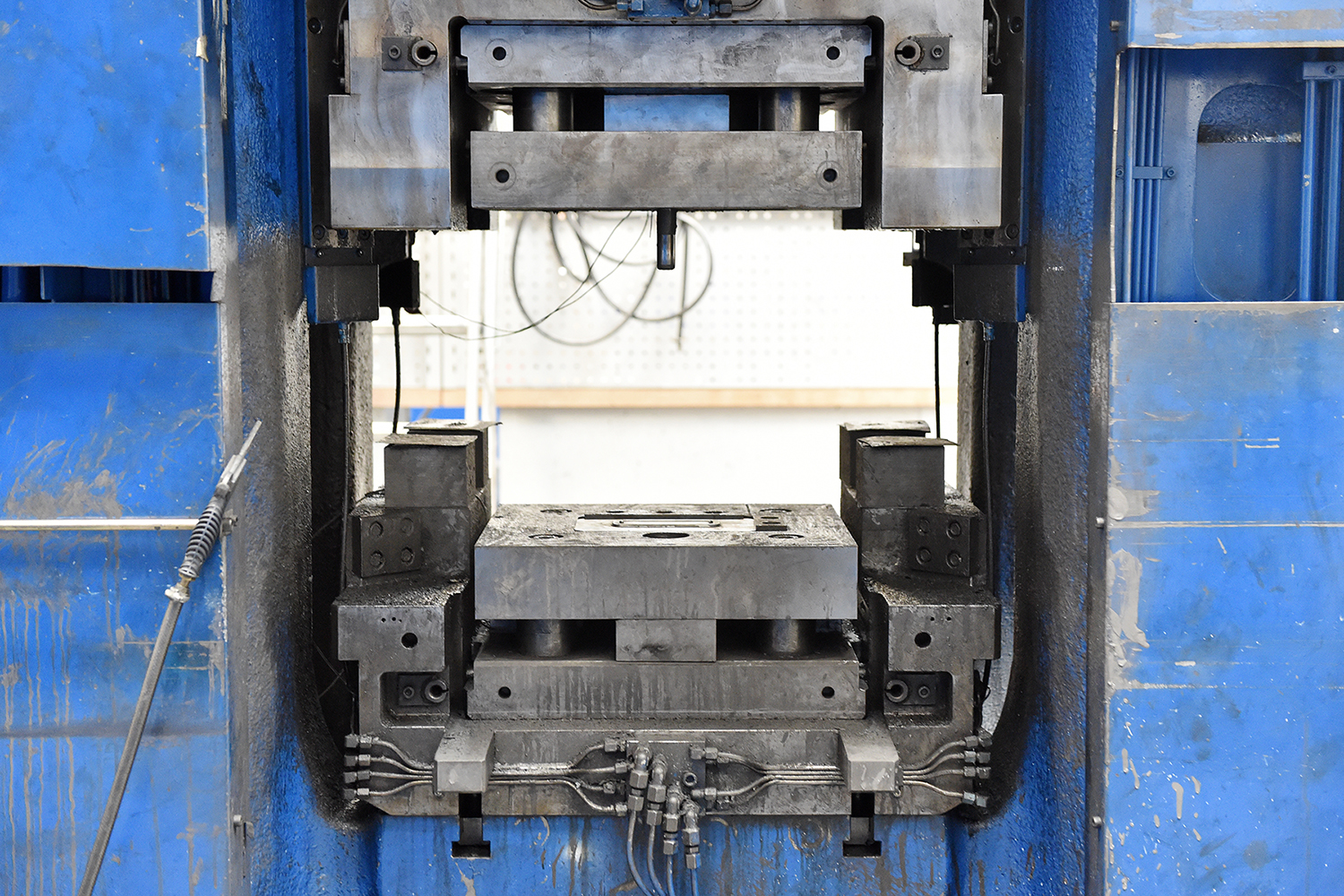Interview mit Michael Plagge, Eclipse Foundation
„Kein Erfolg ohne Mindset-Wechsel“
Ob Elektromobilität, neue Verkehrskonzepte oder autonome Fahrzeuge – die Automobilindustrie wandelt sich radikal. Im Gespräch mit der IT&Production erläutert Michael Plagge, Vice President Ecosystem Development der Eclipse Foundation, welche Rolle Software künftig im Auto spielt und warum Open Source dafür ein wichtiger Schlüssel ist.

Können Sie erklären, was sich hinter einem Software Defined Vehicle verbirgt und wie definieren Sie dieses?
Michael Plagge: Eine einheitliche Definition des Software Defined Vehicle gibt es meiner Ansicht nach nicht. Doch wir beobachten den Trend, dass Endkunden-relevante Features mehr und mehr in Software abgebildet werden und weniger in spezialisierter Hardware. Diese Entwicklung hat auch in anderen Bereichen stattgefunden. Bestes Beispiel ist das Mobiltelefon: Zwar gibt es relevante Hardwarekomponenten wie die Kamera, der eigentliche Mehrwert, also was die Smartphones prägt, sind jedoch die Apps. Die Eigenschaften der Hardware treten in den Hintergrund, die verkaufsrelevanten Features werden durch Software abgebildet. Der Vorteil dabei ist: Software birgt immer die Möglichkeit für Updates, beispielsweise für neue Funktionen. Und das macht das Software Defined Vehicle aus. Keine 90 spezifischen Steuergeräte mehr im Fahrzeug, sondern größere zusammengefasste Computer-Einheiten, die mehrere Funktionen abdecken bzw. mit denen auch zusätzliche Funktionen realisiert werden können, die zum Zeitpunkt der Auslieferung eines Autos noch gar nicht vorhanden waren.
Kennen Sie Beispiele für solche Funktionen?
Ein Beispiel wären etwa Fahrerassistenz-Systeme. Funktionen wie der Mittelspur-Assistent könnten nachträglich aktiviert werden. Auch Volkswagen hat angekündigt, in seinen iD3-Modellen ein Feature zur Batterievorkonditionierung nachzuliefern, dass die Batterie auf Temperatur bringt, kurz bevor das Auto an die Ladesäule fährt. Payment-Prozesse sind ein weiterer Anwendungsfall. Bezahlvorgänge an der Tankstelle oder in Parkgaragen können dann direkt über das Auto abgewickelt werden – ähnlich, wie wir es heute bereits mit dem Handy gewöhnt sind.
Wie kommen die SDV Working Group und Eclipse Foundation ins Spiel?
Als Open Source Community entwickeln wir bei der Eclipse Foundation die Plattform, die als Enabler für neue Geschäftsmodelle dient. Wettbewerbsdifferenzierende Software wird weiterhin proprietär bei den Herstellern liegen. Wir schaffen die Basis, um diese Features zu ermöglichen. Ein weiterer Aspekt ist die Frage nach Kontrolle. Große Plattformen werden heute in der Regel von Unternehmen aus den USA und China kontrolliert, was für Automobilhersteller ein Risiko darstellt. Natürlich wären eigene Plattformen eine Option, aber wir sprechen hier – etwa im Vergleich zum Smartphone-Markt – von deutlich geringeren Stückzahlen. Für Drittanbieter wie Spotify wäre das nicht attraktiv. Ein Auto bietet aber im Vergleich zum Handy vielleicht die besseren technischen Möglichkeiten, also bessere Lautsprecher und größere Screens. Hinzu kommt, dass Neuwagen in der Regel teuer sind. Kunden verfügen also über ein entsprechend hohes Einkommen. Hier liegt Kommerzialisierungpotenzial. Die Frage ist, wer hebt dieses Potenzial? Das können heute Unternehmen wie Google oder Apple sein, aber die Automobilindustrie hat natürlich eine Interesse daran, diese Rolle selbst einzunehmen. Und die Plattform, die hier entsteht, könnte ihnen dabei helfen. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen
KI in Fertigungsbranche vorn

Die SDV-Working Group hat vor gut einem Jahr ihre Arbeit aufgenommen. Was hat sich seitdem getan und wie ordnen Sie Ihre Arbeit im Vergleich zu anderen Initiativen ein?
Der große Unterschied in unserer Herangehensweise ist, dass unser Motto ‚Code first‘ lautet. In den vergangenen zwölf Monaten haben wir Software von unseren Partnerfirmen ‚eingesammelt‘. Rund 20 Projekte haben unsere Mitglieder beigetragen, darunter Projekte von der Cariad, ZF oder Continental. Diese große Vielfalt möchten wir zu einem sinnvollen Ganzen zusammenführen. Und da wir auf der grünen Wiese gestartet sind, brauchen wir natürlich Zeit, um Strukturen zu schaffen und die Projekte am Ende in einen nutzbaren Software-Stack umzuwandeln.
Warum ist der Open Source-Ansatz ein Schlüssel dafür?
Der große Vorteil von Open Source, insbesondere im Rahmen einer Foundation ist, dass Governance-Modelle bereits festgelegt sind. Somit entfallen längere rechtliche Prüfverfahren und Unternehmen müssen im Grunde nur zustimmen bzw. ablehnen. Wir als Eclipse Foundation arbeiten mit einer neutralen Governance. Kein Projektpartner hat mehr Rechte als der andere. Unsere Prinzipien lauten:
- • Offenheit: Jeder kann mitmachen, so lange er sich an das Regelwerk hält.
- • Transparenz: Alle Entscheidungen werden transparent kommuniziert.
- • Vendor-Neutralität: Es gibt keine ausgezeichneten Rollen. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Meritokratie. Wer sich also am meisten einbringt, erhält mehr Verantwortung.
Es gibt aber noch einen anderen Aspekt: Wir haben vor einiger Zeit eine Kooperation mit der Initiative 42 bekanntgegeben. Dabei geht es um die Ausbildung von Entwicklern – und zwar nicht in der klassischen Hörsaal-Situation, sondern durch ein Peer-to-Peer-Training. Betrachtet man etwa den Cloud- oder KI-Markt, können Entwickler von Beginn an mit der Software arbeiten, die sie später im Berufsalltag nutzen. In der Automobilindustrie geht das nicht, da es Stand heute keine Software gibt, die problemlos in der Ausbildung einsetzbar wäre. Der Open Source-Ansatz macht jedoch genau das möglich: Jeder Interessierte kann sich mit einbringen. Entwickler können gleich zu Beginn ihrer Karriere mit relevanten Softwareteilen arbeiten und Firmen erhalten Fachkräfte, die bereits Erfahrung haben und sich direkt einsetzen lassen. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen
Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise
Was sind Ihrer Ansicht nach die größten Hürden auf dem Weg zum SDV und wie könnten sich diese adressieren lassen?
Eine der größten Herausforderungen ist das Mindset: Automobilunternehmen waren und sind stark darin, Hardware herzustellen. Software war lange Zeit nur Beiwerk und nach der Auslieferung eines Pkws mehr oder weniger konstant. Die Möglichkeit, Endkunden-relevante Features in Software abzubilden, wurde daher etwas verschlafen. Hier muss ein Kulturwandel stattfinden. Und ich glaube, dass wir brilliante Technologien haben können, ich glaube allerdings auch, dass wir ohne diesen Mindset-Wechsel nicht erfolgreich sein können. Mit unseren Kollaborationsmodellen wollen wir dazu einen Beitrag leisten.
Wo steht das europäische Mindset im Vergleich zu anderen Regionen?
Wir sind in Europa sehr stark industriell geprägt – was nicht schlecht ist, jedoch verlieren wir dadurch Geschwindigkeit. Statt 110 Prozent reichen im Softwarebereich oft 80 Prozent, was die Time-to-Market beeinflusst. Andere Länder sind uns in diesem Bereich voraus, auch weil sie von einer anderen Basis aus gestartet sind und sie ihr Augenmerk von Beginn an auf Software gelegt haben.
Wie sehen die nächsten Schritte in ihrer Arbeit aus?
Der nächste Schritt wird sein, aus den bereits angesprochenen Projekten erst eine, dann mehrere Distributionen zu entwickeln. Eine zweiter Schritt wird der Austausch mit anderen Organisationen und Initiativen sein, denn wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Gerade diskutieren wir, wie sich die unterschiedlichen Ansätze zusammenführen lassen. Damit Softwareentwickler am Ende des Tages eine einfache Lösung zur Hand haben und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Auf der organisatorischen Seite geht es darum, einen regelmäßigen Austausch zu etablieren, um den notwendigen kulturellen Wandel voranzutreiben.
Vielen Dank für das Gespräch (mst)