Mängelrechte bei KI-Systemen
Fehler im System
Bei physischen Produkten sind Mängel in der Regel schnell festzustellen, oft reicht schon ein Blick. Anders sieht es bei KI-Systemen aus. Wie bei diesen Systemen ein Mangel aussehen kann und wie Unternehmen möglichen Mängeln vorbeugen können, berichtet Rechtsanwalt Kay Diedrich.
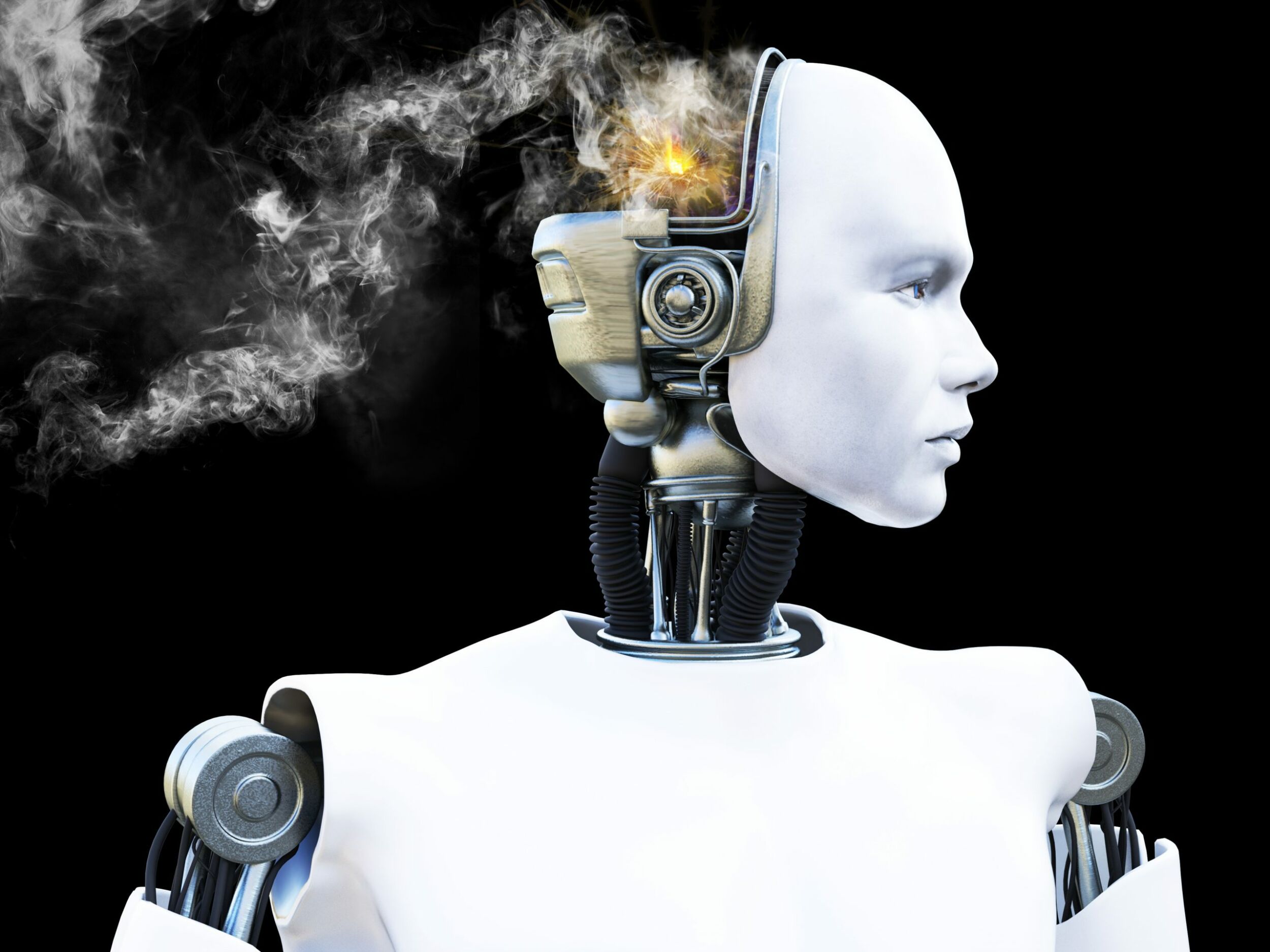
Es liegt in der Natur eines KI-Systems, sich auch beim Nutzer noch weiter zu entwickeln. Die Aufgabe von künstlicher Intelligenz besteht schließlich darin, durch Analyse zu lernen und besser zu werden. Damit stellen sich auch neue Rechtsfragen, beispielsweise wann etwas fehlerhaft ist, das dazu gedacht ist, aus seinen Fehlern zu lernen oder nach welchen Kriterien sich Mängel eines KI-Systems bestimmen und vermeiden lassen – mit den üblichen Folgen wie Rücktritt, Minderung, Schadensersatz.
Verkauf oder Mietmodell
Von der Art der Überlassung eines KI-Systems an den Abnehmer hängt die Kategorie der anzuwendenden Regeln ab: Für die verschiedenen Vertragstypen gelten jeweils spezifische Regeln bei Mängeln. Für vermarktete KI-Systeme ist regelmäßig an Kauf, Miete, Dienst- oder Werkvertrag zu denken. Oft enthält der Vertrag auch eine Mischung dieser Vertragstypen. Entscheidend für die Anwendbarkeit eines bestimmten Vertragstyps ist nicht, welche Überschriften oder Begriffe im Vertrag genannt werden, sondern welche Rechte und Pflichten die Vertragsparteien bei vernünftiger Auslegung mit dem Vertrag bewirken wollten. Ist das KI-System beispielsweise Teil einer zeitweise über ein Datennetzwerk nutzbaren Software (Software as a Service, SaaS), gelten mietvertragliche Regeln. Häufig werden KI-Systeme auch gegen einmalige Vergütung unbefristet überlassen, wodurch Kaufrecht gilt.
Die Sollbeschaffenheit
Wann aber ist ein verkauftes KI-System mangelhaft? Im Grundkonzept muss das dem Käufer überlassene System dem verkauften System entsprechen (Sollbeschaffenheit). Entscheidender Zeitpunkt ist der Gefahrübergang und damit in aller Regel die Überlassung des KI-Systems an den Käufer. Die Sollbeschaffenheit ergibt sich insbesondere aus den Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer, beispielsweise über die anfängliche Leistungsfähigkeit des KI-Systems oder dessen Lernfähigkeit. Diese können sich aus Ausschreibungsunterlagen und Katalogangaben ergeben. Die Vereinbarungen der Parteien sind danach auszulegen, was die beteiligten Personen vernünftigerweise gewollt haben. Das gilt für die Vertragstexte, aber auch für damit verbundene Aussagen und sonstiges Verhalten der beteiligten Personen. Die Kernfrage lautet: Was durfte der Käufer berechtigterweise von der Kaufsache erwarten? Klare Aussagen begrenzen dabei die Risiken: So kann es beispielsweise von den Vertragsparteien gewollt sein, dass ein KI-System von Beginn an eine bestimmte Steigerung der Produktivität herbeiführt. Das System kann etwa unter Verweis auf die Mehrwerte für Produktivität und Nutzbarkeit im Vergleich zu anderen Systemen vermarktet worden sein. Dann muss das System entsprechend liefern. Andernfalls liegt eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und damit ein Mangel vor. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen
KI in Fertigungsbranche vorn
Wenn das System noch lernt
Es kann aber auch vereinbart sein, dass das KI-System bestimmte Leistungen nach Gefahrübergang erst noch erlernt. Denn Beschaffenheit kann grundsätzlich jeder tatsächliche, wirtschaftliche oder rechtliche Umstand im Zusammenhang mit der Kaufsache sein. Dann hätten die Parteien also die Beschaffenheit ‚lernend‘ vereinbart. Die Kaufsache muss diese Lernfähigkeit bei Lieferung aufweisen. Das KI-System ist jedoch mangelhaft, wenn es nicht, falsch oder zu langsam lernt. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die vom Käufer zu erfüllenden Anforderungen für Training, Pflege und Nutzung des KI-Systems. Soweit der erfolgreiche Einsatz bestimmtes Verhalten des Nutzers erfordert, muss das im Kaufvertrag festgelegt werden.
Überleistung kann Mangel sein
Die Notwendigkeit bewusst gesteuerter Vereinbarungen zeigt auch folgendes Beispiel kurioser Rechtsanwendung: Ein KI-System kann sogar dann mangelhaft sein, wenn die Leistungen das Vereinbarte übertreffen. Über übliche Vorsicht bei Angaben zur Leistungsfähigkeit hinaus ist also gerade bei KI-Systemen besondere Aufmerksamkeit für die Leistungsbeschreibung gefordert. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise
Ohne Vereinbarung
Wurde keine Beschaffenheit vereinbart, liegt ein Mangel vor, wenn die Kaufsache sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Dieser Verwendungszweck muss für den Verkäufer bei Vertragsschluss erkennbar sein. Auch hier gelten die zuvor genannten Regeln der Auslegung. Ohne konkrete Vereinbarungen oder erkennbaren Verwendungszweck ist die verkaufte Sache nur dann mangelfrei, wenn sie
- • sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,
- • eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und
- • die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.
In diesem Sinne gehören auch Eigenschaften zur Beschaffenheit, die der Käufer aufgrund öffentlicher Äußerungen des Verkäufers oder Herstellers erwarten kann. Im Kern geht es um die berechtigte Erwartungshaltung im Vergleich zu Sachen gleicher Art, was gerade bei neuartigen Sachen wie einem KI-System zu Unklarheiten führen kann. Als Maßstab muss ein Markt für rechtlich vergleichbare Systeme bestimmt werden. Für die Vergleichbarkeit sind unterschiedliche, noch nicht genau geklärte Faktoren wesentlich, z.B. die jeweils gewählten technischen Ansätze. Auch hier können durch bewusste Vertragsgestaltung wesentliche Weichen gestellt werden. Für den jeweiligen Vergleichsmarkt ist zu bestimmen, welche Beschaffenheit ein Käufer von einem KI-System erwarten kann – daran ist das verkaufte KI-System zu messen. Bei Abweichungen drohen Mängelansprüche.
Erwartungen bewusst steuern, Verträge bewusst gestalten
Verkäufer eines KI-Systems – inklusive Maschinen und Anwendungen, die die Technologie verwenden – sollten bei der Vermarktung die Erwartungen und Vereinbarungen bewusst steuern. Sonst drohen gerade bei den noch neuartigen Anwendungen Risiken wegen Mangelansprüchen. Käufern bieten die Unklarheiten die Chance, den Verkäufer über das sonst übliche Maß hinaus in Anspruch zu nehmen. Durch bewusste Vertragsgestaltung kann der Käufer seine Rechte sogar noch erheblich ausweiten.











































